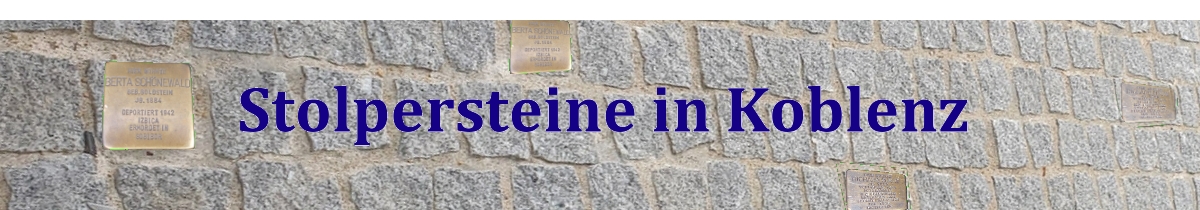Am 22. März 2018 trafen sich Jugendliche der Amadiyya-Gemeinde Koblenz und unser stellvertretender Vorsitzender Joachim Hennig zum Putzen von „Stolpersteinen“. Anlass war ein dreifacher: An diesem Tag jährte sich zum 76. Mal die 1. Deportation von Juden aus Koblenz und Umgebung „nach dem Osten“ und damit in den Holocaust. Auch war die diesjährige Woche der Brüderlichkeit (11. – 18. März 2018) gerade beendet und die beiden Wochen gegen Rassismus (12. bis 25. März 2018) neigten sich dem Ende zu. Es gab also genug Anlass, sich an die Menschheitsverbrechen der Nazis und ihrer Opfer zu erinnern.
Über diese gelungene Veranstaltung berichtete der „Schängel“ Nr. 13 vom 28. März 2018 in seiner Reihe „Erinnerung an NS-Opfer“.
Lesen Sie dazu den Artikel HIER und betrachten Sie die nachfolgende Bilderstrecke.
10. Verlegeaktion von "Stolpersteinen". (v. 15.05.2016)
Am 12. März 2016 wurden zum 10. Mal in Koblenz "Stolpersteine" verlegt. Alle damit bedachten NS-Opfer waren jüdische Bürger.
Ein Stein erinnert in Koblenz-Metternich gegenüber der Trierer Straße 316 an Karl Siegler. Dort wurde er am 6. April 1904 als Sohn der Eheleute Hermann Josef Siegler und Amalie, geb. David, geboren. Er war das 10. von 11 Kindern. Wie sein Vater, der bis zu seinem Tod im Jahr 1930 eine Metzgerei in der Trierer Straße 316 betrieb, wurde Karl Metzger. Er heiratete dann eine Nichtjüdin, die evangelische Christin Dorothee Helene Thelen, geborene Rohleder. Weil er Jude war, wurde Karl Siegler zunehmend ausgegrenzt und schikaniert. Er verlor seine Arbeit und musste von der Fürsorgeunterstützung leben. Dabei brachten ihn die immer restriktiveren Gesetze schon bald ins Gefängnis: Weil er gewisse Nebeneinkünfte gegenüber dem Wohlfahrtsamt nicht angegeben hatte - so der Vorwurf -, musste er für drei Monate in Haft. Dies war für das Nazi-Organ "Koblenzer Nationalblatt" ein gefundenes Fressen, um ihn und damit "die" Juden an den Pranger zu stellen. Kaum wieder in Freiheit wurde er im Rahmen der Novemberpogrome ("Reichspogromnacht" am 9./10. November 1938) in das Konzentrationslager Dachau bei München verschleppt. Nach einigen Wochen kam er wieder frei und musste dann als dienstverpflichteter Jude Arbeiten im Straßenbau und beim NS-Kraftfahrkorps leisten. Wegen seiner Ehe mit einer "Arierin" blieb er von den ab März 1942 stattfindenden Deportationen jüdischer Bürger verschont. Das änderte sich aber, als seine Frau im Januar 1944 starb. Wiederum brachte man ihn - der Grund dafür ist nicht bekannt - ins Gefängnis. Als der schwere Luftangriff der Alliierten Anfang November 1944 die Altstadt von Koblenz weitgehend und auch das Gefängnis zerstörte, konnte Karl Siegler fliehen. Ihm gelang es, mit Hilfe von Unterstützern sich in einer Mühle im Maifeld zu verstecken und so zu überleben. Nach der Befreiung kehrte er nach Koblenz-Metternich zurück. Dort betrieb er eine Metzgerei. Das war erst in den Räumen eines ermordeten jüdischen Metzgers, dann - nach einem jahrelangen Rechtsstreit um das elterliche Eigentum (seine Mutter war 1943 ins KZ Theresienstadt deportiert worden und dort umgekommen) - setzte er sein Geschäft in der Trierer Straße 316 fort. Siegler war ein großer Förderer des Sports in Metternich, des Fußballvereins Germania Metternich und des Ringerclucs ASV Eiche Metternich. Karl Siegler starb 1967 und ist auf dem jüdischen Friedhof von Koblenz begraben.
Lesen Sie dazu bitte:
Blick aktuell - Ausgabe Koblenz - Nr. 13/2016 vom 31. März 2016, Seite 6
Wir von hier - Beilage zur Rhein-Zeitung - Nr. 14 vom 8. April 2016

Weitere Stolpersteine verlegte Gunter Demnig für die Familie Hellendag.(s. Bild oben) Das Schicksal dieser holländisch-deutschen Familie (Vater, Mutter und Tochter Eva), die in Koblenz-Horchheim beheimatet war, ist dank der vielfältigen Erinnerungsarbeit unvergessen. So gibt es von der Tochter Eva eine Autobiografie (Eva Salier: Lebensweg einer Koblenzer Jüdin, Annweiler 2001). Und unser Förderverein dokumentiert ihr Schicksal auf einer Personentafel in der Dauerausstellung, sowie auf dieser Homepage , auf der Personentafeln Nr.45
Auch halten die Horchheimer Heimatfreunde die Erinnerung an die im letzten Jahr in den USA verstorbene Eva Salier wach. Einen Presseartikel dazu lesen sie bitte bei: Blick aktuell - Ausgabe Koblenz - Nr. 14/2016 vom 7. April 2016
Die 10. Verlegeaktion fand ihren Abschluss in der Rizzastraße 37. Dort wurden für die Familie Cohn 6 Steine verlegt. Die Chons lebten in Koblenz in - wie man so sagt - gutbürgerlichen Verhältnissen. Der Ehemann Siegfried betrieb das Schuhhaus Fischel im Entenpfuhl, seine Frau Selma zog die drei Kinder auf: das älteste, die Tochter Anneliese, und die beiden Jungen Walter Joseph und Kurt. Dann brach auch über diese jüdische Familie die Katastrophe des Nationalsozialismus mit seinem Rassenwahn herein. Immer mehr spürten sie, wie sie im Alltag ausgegrenzt und schikaniert wurden. Auch machten die Nazis und ihre Helfer es ihnen immer schwerer, ihr Schuhgeschäft zu betreiben. Im Rahmen der Novemberpogrome 1938 ("Reichspogromnacht" vom 9./10. November 1938) nahm man den Vater Siegfried und die Söhne Walter Joseph und Kurt in in Koblenz in "Schutzhaft" und verschleppte sie in das Konzentrationslager Dachau bei München. Nach einiger Zeit kamen sie wieder frei. Der Vater kehrte nach Koblenz zu seiner Familie zurück, die beiden Söhne emigrierten. Walter Joseph floh in die USA, Kurt nach Australien. Beide fassten dort Fuß, gründeten eine Familie und schufen sich eine neue Existenzgrundlage. Für die Eltern Siegfried und Selma Cohn gingen in Koblenz die Schikanen weiter. Sie mussten ihr Haus verlassen und in ein sog. Judenhaus zusammen mit anderen Juden umziehen und in sehr beengten Verhältnissen leben. Im Jahr 1942 wurden sie zusammen mit vielen anderen Koblenzer Juden "in den Osten" deportiert, in das polnische Städtchen Izbica im sog. Generalgouvernement. Dort fanden sie den Tod. Entweder kamen sie in den menschenunwürdigen Verhältnissen in Izbika um oder sie wurden Monate später in ein in der Nähe gelegenes Vernichtungslager (wahrscheinlich Sobibor oder auch Chelmno) verschleppt und dort mit Giftgas ermordet. Ihre Tochter Anneliese, die inzwischen geheiratet hatte und mit ihrem Mann Robert Fröhlich in Köln lebte, wurde von dort mit ihm zusammen zunächst in das Ghetto Lodz (Litzmannstadt) deportiert und dann im Vernichtungslager Chelmno mit Giftgas ermordet.